Bildung auf dem digitalen Holzweg
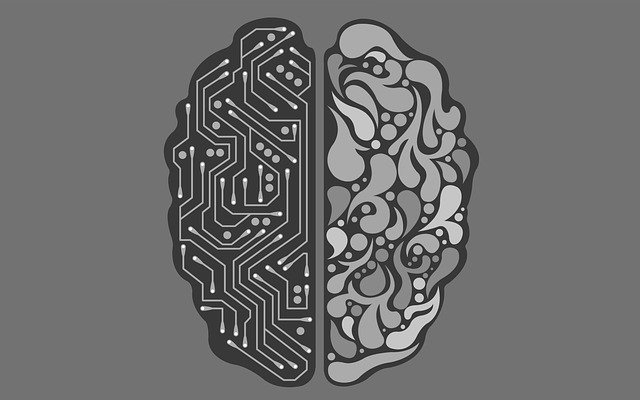
Die Covid-Pandemie stellt die gesammte Gesellschaft vor große Herausforderungen. Doch gerade im Bildungssektor zeigten sich die Auswirkungen der bislang unterbliebenen Digitalisierung. Wir sprachen mit Ingo Leipner über die Digitalisierung der Bildung, über sensomotorische Integration und Manipulationstechniken im digitalen Raum.
ZV: Herr Leipner, wie beurteilen Sie den Online-Fernunterricht der Schulen während der Covid-19-Pandemie?
IL: Viele Schulen haben die Digitalisierung des Unterrichts mangelhaft vorbereitet. Deshalb begnügten sich die Lehrerinnen und Lehrer oft damit, den Schülerinnen und Schülern Aufgabenpakete nach Hause zu schicken. Sie nutzen an vielen Stellen nicht die interaktiven Möglichkeiten, die zum Beispiel Videokonferenzen bieten.
ZV: Was folgt für Sie daraus?
IL: Ich denke, wir haben vor allem gesehen, wie wertvoll der direkte Unterricht im Klassenzimmer nach wie vor ist und bleiben wird. Kein virtuelles Setting – und sei es auch besser organisiert – kann die Resonanz, also das „Mitschwingen“ der Schüler im Unterricht, ersetzen: den Kontakt der Lehrer zu den Kindern und die Wahrnehmung des Lehrers durch die Kinder. Der Austausch am Bildschirm ist demgegenüber extrem reduziert und senkt die Qualität des Unterrichts.
ZV: In welcher Lebensphase ist dieser nicht-digitale Zugang besonders wichtig?
IL: Dieser Zugang ist besonders in der Altersgruppe von der Geburt bis zum 12. bzw. 14. Lebensjahr wichtig. In dieser Lebensphase gilt es, die sensomotorische Integration der Kinder zu fördern. Das bedeutet auf der sensorischen Ebene, dass Kinder über ihre Sinne die Welt erst einmal so erfahren sollten, wie sie tatsächlich ist: Sie springen über eine Wiese, sie stauen einen Bach, sie spielen Fußball oder toben in einem Stadtpark. Das sind reale Eindrücke, die kein Bildschirm der Welt vermitteln kann. Und auf der motorischen Ebene müssen sich Kinder gerade in diesem Alter möglichst viel körperlich bewegen, um fein- sowie grobmotorische Aufgaben zu lösen, etwa beim Sport oder beim Basteln. Auch das hat nichts mit Handys, Tablets und Bildschirmen zu tun.
Sensomotorische Integration und kognitiv-emotionalen Entwicklung
ZV: Weshalb ist diese sensomotorische Integration so wichtig?
IL: Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der sensomotorischen Integration und der kognitiv-emotionalen Entwicklung. So lernen Kinder zum Beispiel bei der Tätigkeit im Schulgarten Impulskontrolle: Sie müssen sich zurückhalten und pflegerisch tätig werden, damit die Zucchini gut gedeihen, haben also nicht umgehend das Erfolgserlebnis einer Ernte. Sie müssen Entwicklungen beobachten, gießen und Unkraut jäten.
Diese Fähigkeiten benötigen die Kinder später als Jugendliche, um das Reizbombardement des Internets besser kanalisieren zu können, sich nicht von der Vielzahl der digitalen Möglichkeiten davonspülen zu lassen und zu sagen: „Nein, ich schalte jetzt auch einmal den Computer aus.“ Man spricht in diesem Zusammenhang von einer indirekten Medienpädagogik: Wir statten Kinder erst einmal mit der Kompetenz aus, das Leben in seiner ganzen Vielfalt erobern zu können. Auf dieses Fundament kann dann die direkte Medienpädagogik aufbauen.
Wenn wir hingegen Kinder zu viel vor Bildschirmen parken, reduzieren wir ihre sensorischen Eindrücke auf ein oder zwei Kanäle – Sehen und Hören – und schränken ihre Bewegungsmöglichkeiten ein. Wir erschweren so ihre gesunde Entwicklung. Ich sehe hier gerade Kindergärten und Grundschulen in der Pflicht, die überstarke Nutzung digitaler Geräte in den Privathaushalten zu kompensieren.
ZV: Später könnten dann aber Elemente des digitalen Lernens hinzutreten?
IL: Ja, natürlich. Der Erwerb digitaler Kompetenzen ist heute zentral. Das sind wunderbare technologische Möglichkeiten. Es wäre naiv, Kinder und Jugendliche davon gänzlich fernzuhalten. Wenn Kindergärten und Grundschulen die Heranwachsenden für diese Welt stark gemacht haben, können weiterführende Schulen Informatikunterricht anbieten und dort den Jugendlichen beibringen, wie man programmiert, einen SEO-Text verfasst, fotografiert und gute Videos anfertigt. So können die Schülerinnen und Schüler auch ein Gefühl für die Gefahren von Manipulationstechniken und Fake News entwickeln.
Manipulationstechniken im digitalen Raum
ZV: Und gerade Manipulationstechniken sind ja im digitalen Raum weitverbreitet …
IL: Ja. Bei aller Faszination für digitale Medien, Computerspiele und die Möglichkeiten des Internets müssen wir die hier lauernden Abhängigkeits- und Suchtpotenziale klar benennen und mit Kindern und Jugendlichen besprechen. Diese Gefahren tauchen in Form intermittierender Verstärkungspläne auch bei ganz harmlosen Bauernhofspielen auf: Dem Spieler eröffnet sich zufallsgeneriert die Möglichkeit, etwas zu gewinnen, aber er weiß nie genau, ob und wann er gewinnt. Er wird kontinuierlich auf die Folter gespannt und diese Unsicherheit kann in die Abhängigkeit führen.
Und dieser Mechanismus greift übrigens auch in den Sozialen Medien. Wir scrollen immer weiter durch den Thread, nur um zu sehen, ob noch etwas Interessantes kommt. Diese Ungewissheit hält uns am Bildschirm. Hinter diesem „User-Engagement“ steht eigentlich nur die Absicht der Plattformbetreiber, uns möglichst lange am Bildschirm festzuhalten. Das erhöht nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Werbung klicken, die Umsatz generiert.
ZV: Ein weiterer Kritikpunkt gegenüber Sozialen Medien ist ja die ungebrochene Daten-Sammelwut. Wie sieht das bei digitalen Lern-Plattformen aus?
IL: Auch dort werden im Rahmen des Learning Analytics Daten gesammelt. Wir müssen uns klar machen, dass bei der Nutzung eines individualisierten Lernprogramms, das sich genau auf die Schwächen und Stärken des Schülers einstellt, immer ein Rückkanal aktiv ist: Alle Aktionen des Schülers werden erfasst und an den Hersteller übermittelt – also, ob der Schüler die Aufgaben richtig oder falsch löst, wie lange er benötigt, um mit der Tastatur ein Wort einzugeben, wie seine Konzentrationswerte sind und eine Vielzahl weiterer Parameter. Nur über eine solche Daten-Auswertung kann der Hersteller ja analysieren, auf welcher Stufe der Schüler gerade steht.
Das hat im Fall der Fälle aber zur Folge, dass von der ersten Klasse an gigantische Protokolle über das Lernverhalten der Schüler angefertigt und stetig erneuert werden. Der Hersteller kann mit diesen Daten dann wiederum arbeiten.
Was nichts kostet…
ZV: Und das kann problematisch werden?
IL: Ja. In den USA gab es vor ein paar Jahren die ersten großen MOOCs – Massive Open Online Courses, zum Beispiel 10 bis 20 kostenlose, weltweit abrufbare Videovorlesungen. Die Veranstalter warben damit, dass diese Vorlesungen von den besten Professorinnen und Professoren der Welt gehalten werden. Aber worauf basiert das Geschäftsmodell, wenn die Kurse selbst kostenlos sind? Das sind die Daten: Aufgrund der protokollierten Leistungen der Teilnehmer konnten die Betreiber Profile erstellen, mit denen sie wiederum Unternehmen bei der Personalsuche berieten.
ZV: Also muss man auch sehr genau darauf achten wie die angeblichen Einspareffekte des digitalen Lernens zustande kommen?
IL: Es ist ein altes Prinzip, dass man kostenlose Angebote im Internet mit den eigenen Daten bezahlt. Ich wage jedoch zu bezweifeln, dass ein solches Geschäftsmodell für den Bildungsprozess in der Schule legitim ist. Es kann ja nicht sein, dass die Schüler für die Nutzung eines Programms mit ihren Daten bezahlen.
Ich will den Blick aber auf ein anderes Problem der Learning Analytics lenken: In den USA wurden universitäre Prognoseprogramme erprobt, die Leistungen, soziodemographische Daten und die Herkunft der Studentinnen und Studenten analysierten, um die Chancen auf einen Abschluss in einem bestimmten Fach zu prognostizieren. Das war für die Universitäten natürlich ein großer Gewinn, denn die Abbrecherquoten sanken stark.
Allerdings entlastet ein Algorithmus zwar die Menschen, er nimmt ihnen aber zugleich ihre Selbstständigkeit. Wenn ein junger Mensch nicht mehr erwägen muss, ob er für ein bestimmtes Studienfach geeignet ist oder nicht, sondern sich auf die Aussage eines Algorithmus verlässt, wird er ein Stück weit selbst entmündigt. Und wenn er alles richtig macht, hat er am Ende vielleicht einen makellosen Lebenslauf, aber im Irrtum, im Umweg und im Scheitern steckt ja das Potenzial zu einer echten persönlichen Entwicklung.
ZV: Und viele Beispiele aus den USA zeigen ja, dass sozial Schwache die Verlierer der Algorithmen-Kalkulation sind. Könnte das auch in Bezug auf das digitale Lernen der Fall sein?
IL: Es gibt in den USA die sogenannte Preschool, eine Ausbildungsstufe ein Jahr vor dem Kindergarten. Die öffentlichen Preschools leiden unter einem schmalen staatlichen Budget. Private Organisationen bieten deshalb computergestützte, virtuelle Preschool-Bildung an und setzen die Kinder so gleichsam vor den Rechner. Das trifft vor allem ärmere Kinder. Reiche Eltern können sich hingegen private Preschools leisten, mit Erzieherinnen und Erziehern und anderen Kindern und richtigen Spielen. Hier kann man gut sehen, wie die gefällige digitale Ware denen vorgesetzt wird, die kein Geld haben.
Haptisch erfahrbare Bildung
ZV: Und worin liegen die Vorteile des Lernens mit Büchern gegenüber dem Lernen am Bildschirm?
IL: Fünf Forschungsergebnisse sprechen für das gedruckte Wort: Erstens kann ich beim Arbeiten mit einem Buch das Gelesene auch haptisch erfahren. Das Lesen auf einem Tablet oder Smartphone ist hingegen immer ein nicht-greifbarer, sehr abstrakter Prozess: Ich scrolle durch die Seiten, habe aber kein Gefühl dafür, was ich wo und wie viel gelesen haben.
Zweitens können Personen, die am Bildschirm lesen, zwar die Inhalte ebenso gut wie die Buchleser memorieren, Buchleser können allerdings die Struktur – wie etwa die Gliederung der Kapitel und Absätze – viel besser erinnern.
Drittens lesen Bücherfreunde konzentrierter. Die heutigen Menschen haben gelernt, am Bildschirm zu scannen: Sie rutschen gleichsam durch den Text und orientieren sich höchstens an einem Link oder an einer Zwischenüberschrift, die wie ein Anker wirken.
Viertens gibt es Hinweise darauf, dass uns die Links in Onlinetexten für Bruchteile von Sekunden verunsichern: Sollen wir den Text weiterlesen oder sollen wir auf den Link klicken? Das ist eine dauerhafte Störung. Hinzu tritt das starke, störende Flimmern aller möglicher Werbung, etwa auf Spiegel Online.
Und noch ein fünfter, wichtiger Punkt: Das Lesen eines Buches setzt eine Willenshandlung voraus. Ich muss mich Seite für Seite durch Texte – auch komplizierte – arbeiten. Eine vergleichbare Lernsoftware geht hingegen oft davon aus, dass Lernende nur durch ein Feuerwerk an Gamification-Elementen wie Quiz, Videos und kurzen Textsequenzen zu begeistern ist – und nicht mehr aus einer inneren, intrinsischen Motivation. Diese innere Motivation wird durch die extrinsische Motivation korrumpiert. Ich schaffe es nicht mehr, einen Fachtext so lange zu lesen, bis ich ihn verstanden habe. Deshalb haben wir ja bereits in vielen Studiengängen das Phänomen, dass das Lesen langer Texte nicht mehr populär ist.
ZV: Vielen Dank für das Gespräch.
Der Diplom Volkswirt und Wirtschaftsjournalist Ingo Leipner, ist Autor kritischer Bücher zur Digitalisierung der Gesellschaft. Er ist auch ein gefragter Referent in Sachen Digital-Kritik und leitet seine eigene Textagentur EcoWords.
 In seinem Buch „Die Katastrophe der digitalen Bildung“ zeigt Leipner, dass die Debatte über digitale Bildung auf dem Holzweg ist – und das sogar in Zeiten einer Pandemie.
In seinem Buch „Die Katastrophe der digitalen Bildung“ zeigt Leipner, dass die Debatte über digitale Bildung auf dem Holzweg ist – und das sogar in Zeiten einer Pandemie.
Beitragsbild: pixabay.com

